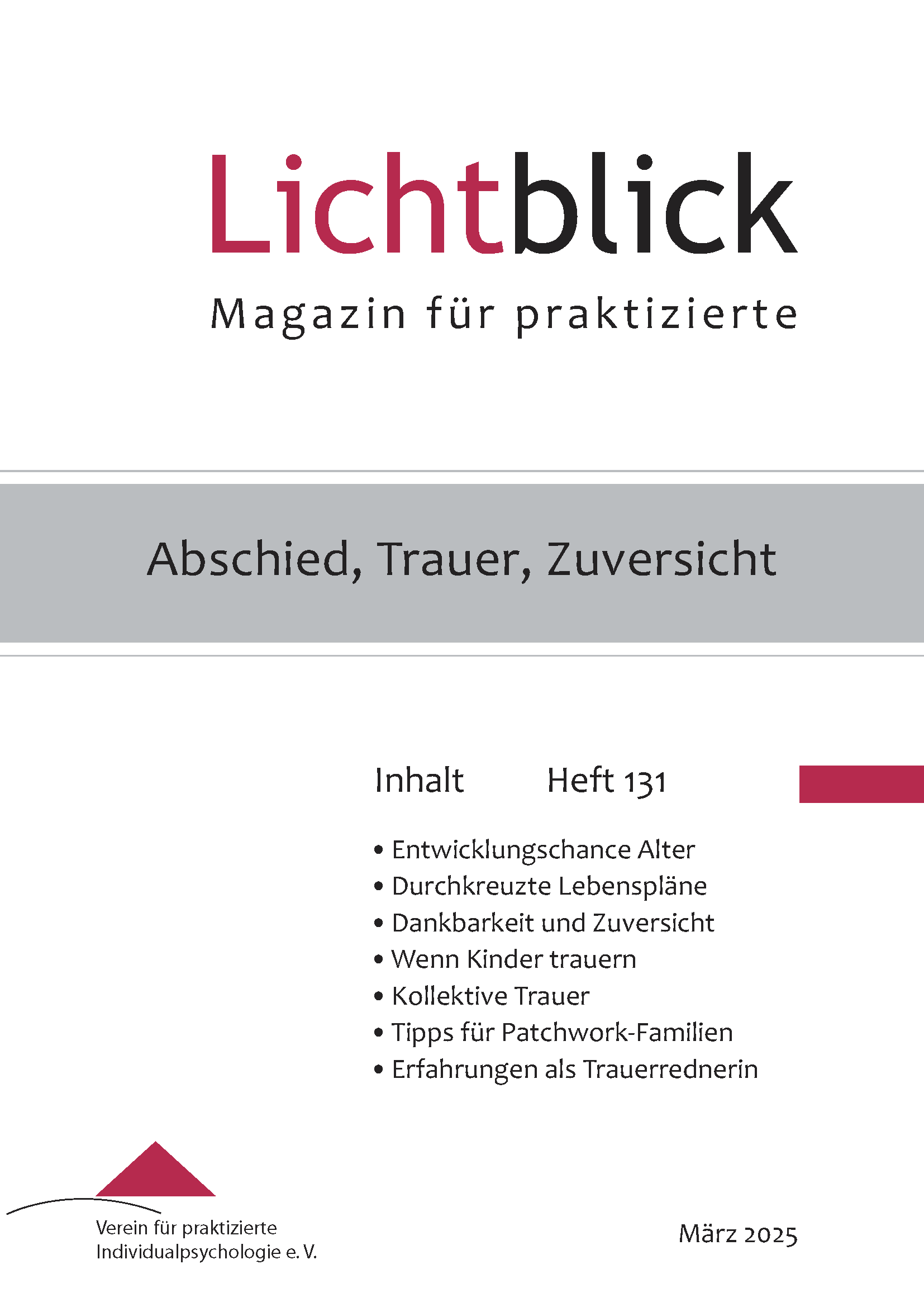Wenn Kinder trauern
Simone Ringler möchte Mut machen, mit Kindern über Tod und Trauer zu reden.
bearbeitet von Jana Strahl
Trauer ist für jeden von uns von großer Bedeutung. Wenn ich jedoch meinen beruflichen Terminkalender betrachte, stelle ich fest: Die Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Trauer“ werden sehr selten gebucht – ehrlich gesagt immer nur rund um Allerheiligen. Den Rest des Jahres scheint man lieber „trauerfrei“ bleiben zu wollen. Um das Thema „Kinder und Trauer“ wird häufig ein großer Bogen gemacht, denn wir wünschen uns, dass unsere Heranwachsenden mit Gefühlen wie Freude, Glück und Zufriedenheit durchs Leben gehen. Doch reicht das aus?
In Workshops und Seminaren zeige ich den Teilnehmenden gerne eine Batterie und frage sie, welcher der beiden Pole entscheidend sei, damit die Energie fließt. Schnell wird klar, dass wir beide Pole benötigen. Ich glaube, dass die Batterie Sinnbild für unser Leben sein kann: Auch hier brauchen wir beide Pole. Wenn es uns gelingt, Freude und Trauer gleichermaßen Raum zu geben und das gesamte Gefühlsspektrum zuzulassen, macht uns das zu selbstbewussten und resilienten Persönlichkeiten.
Trauer im Alltag und Verständnis vom Tod
Werden Menschen mit dem Thema „Trauer“ konfrontiert, steht schnell die Assoziation mit dem Tod im Vordergrund. Es gibt jedoch zahlreiche andere Anlässe, die traurig machen können – beispielsweise der Verlust eines Kuscheltiers, die räumliche Distanz zu Freund:innen durch einen Wohnortwechsel, Liebeskummer, Lebensphasenwechsel wie die Pubertät, das Ende der Schulzeit oder der Auszug aus dem Elternhaus.
Schon als Kind hören wir Sätze wie: „Das ist doch nicht so tragisch“ oder „Mach doch bitte jetzt kein Drama.“ Kommen Kinder mit negativen Emotionen in Berührung, neigen die begleitenden Erwachsenen häufig dazu, diese herunterzuspielen oder die Kinder abzulenken. Wie leicht fällt es uns, auch die negativen Gefühle unseres Gegenübers auszuhalten? Wenn Kinder in ihrem Alltag lernen, dass es in Ordnung ist, zu weinen, können sie Schritt für Schritt lernen, mit Verlust, Abschied und Trauer umzugehen. Resilienz entsteht durch Erfahrungen, die wir den Kindern durchaus zumuten dürfen. Ein besonderer Aspekt der Trauer bei Kindern ist die Trauer nach einem Todesfall. Blicken wir zurück, so war früher der Tod in (Groß) Familien noch allgegenwärtig. Heutzutage wird hauptsächlich in Institutionen gestorben: in Kliniken, Altersheimen und Hospizhäusern. Allerdings sehen viele Kinder und Jugendliche in Filmen und Computerspielen unzählige Tote, zumal man beim Gaming sogar mehrmals sterben kann, da man ja mehrere „Leben“ hat.
Kinder entwickeln ihr Verständnis vom Tod schrittweise, abhängig von ihrem Alter, ihrer kognitiven Entwicklung und ihren persönlichen Erfahrungen. Kinder bis zum dritten Lebensjahr nehmen Verlust und Trennung wahr, haben jedoch noch kein Konzept vom Tod. Kinder zwischen drei und sechs Jahren betrachten den Tod als vorübergehenden Zustand und können daher glauben, dass Verstorbene zurückkehren würden. Ab dem sechsten Lebensjahr wissen Kinder um die Endgültigkeit des Todes. Die eigene Sterblichkeit steht zu Beginn dieser Phase noch nicht im Vordergrund und wird erst später realisiert.
Kinder trauern anders
Kinder haben in Bezug auf ihre Trauerreaktionen eine von Natur aus sprunghafte Zugangsweise. Diese schützt sie vor der überwältigenden Intensität der Trauer. Während bei Erwachsenen das Bild vom „Durchwaten eines Trauerflusses“ Verwendung findet, verdeutlicht das Verhalten der Kinder, dass sie von einer Trauerpfütze zur nächsten springen – und dazwischen existieren trauerfreie Zonen. Dies zeigt sich oft darin, dass sie in einem Moment tieftraurig sind und kurz darauf wieder fröhlich spielen können. Ein solches Verhalten irritiert manchmal die begleitenden Erwachsenen, da viele von ihnen den Begriff des „Trauerjahres“ kennen, in dem Spaß, Unterhaltung und Feiern keinen Platz haben. Für Kinder sind diese Unterbrechungen der Trauer jedoch dringend notwendig. Manchmal ist dies auch der Grund dafür, warum sie den Todesfall verheimlichen, etwa im Kindergarten, in der Schule oder im Sportverein.
Unsere Gesellschaft ist von einer gewissen Distanz zum Tod und zu den Toten geprägt. Kinder und Jugendliche wollen hingegen im wahrsten Sinne des Wortes den Tod „begreifen“. Es ist daher hilfreich, wenn Kinder bereits vor der Beerdigung die Möglichkeit haben, sich von den Verstorbenen zu verabschieden. Oft besteht der Wunsch, den Verstorbenen nahe zu sein und sie zu berühren. Werden Kinder gut vorbereitet und einfühlsam begleitet, können sie den Tod – oder besser gesagt, die damit verbundene Kälte – besser begreifen und den Abschied angemessen einordnen.
Die Beerdigung stellt ebenfalls ein bedeutendes Ereignis für Kinder dar. Genauso, wie wir sie sorgfältig auf ihren ersten Schultag vorbereiten, sollten wir sie auch auf eine Beerdigung vorbereiten. Dabei ist es wichtig, dass sie von einer stabilen Bezugsperson begleitet werden, die nach Möglichkeit nicht zu sehr selbst betroffenen ist. Diese sollte ihnen jederzeit die Möglichkeit bieten, das Geschehen zu verlassen und bei Bedarf wieder zurückzukehren. Abhängig vom Alter sollten Kinder in die Vorbereitung der Verabschiedung einbezogen werden, um ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit zu vermitteln.
Gespräch mit Kindern in der Trauer
Trauer macht uns tendenziell sprachlos, und wir sind wenig geübt darin, mit Trauernden zu sprechen. Ganz im Gegensatz zur Ohnmacht der Erwachsenen stellen Kinder ungeniert immer und überall Fragen und können mit ihrem immer wiederkehrenden „Warum?“ Erwachsene in die Verzweiflung treiben.
Für das Gespräch mit Kindern, die von Trauer betroffen sind, ist es hilfreich, das Bild der Trauerpfützen zu nutzen. Es ist daher ratsam, genau auf die Fragen der Kinder zu antworten, jedoch ohne zu ausschweifend zu werden. Sie holen sich in der Regel die Informationen „häppchenweise“ und benötigen dann wieder eine Zeit, um das Gehörte verdauen zu können. Auch die Haltung des „Nichtwissens“ ist in der Trauerbegleitung eine gesunde Reaktion. Besonders auf die Frage „Was kommt danach?“ haben wir keine allgemeingültige Antwort. Hier können wir mit einer Gegenfrage mit dem Kind ins Gespräch kommen („Was stellst du dir denn vor?“) und im Falle ungünstiger Vorstellungen korrigieren.
Als Erwachsene fällt es uns manchmal schwer, die Begriffe „Sterben“ und „Tod“ in den Mund zu nehmen. Häufig wählen wir Umschreibungen. Diese können jedoch für Verwirrung bei den Kindern sorgen, da ihre Abstraktionsfähigkeit noch nicht vollständig entwickelt ist und sie diese Umschreibungen oft wortwörtlich nehmen. Hier einige Beispiele:
- „Opa ist eingeschlafen.“ (➡ Er kann wieder aufwachen.)
- „Oma hat sich auf die Reise gemacht.“ (➡ Sie kommt wieder nach Hause.)
- „Wir haben Opa verloren.“ (➡ Wir müssen ihn wiederfinden.)
- „Mama starb, weil sie krank war.“ (➡ Wer krank ist, stirbt.)
- „Oma ist im Himmel – da hat sie es besser.“ (➡ Auf der Erde ist es schlecht.)
- „Papa schaut jetzt von der Wolke auf uns herab.“ (➡ Wolkenloser Himmel – was jetzt?)
- „Wir müssen sterben, um auf der Welt Platz zu machen.“ (➡ Wem habe ich den Platz genommen?)
Ein wunderbarer Zugang, um mit Kindern in Kontakt mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu kommen, sind Bilderbücher. In der Trauerbegleitung mit Kindern ist ein kreativer, spielerischer Zugang sehr hilfreich. Fällt es Kindern schwer, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen, unterstützen neben Bilderbüchern auch Kuscheltiere, Puppen oder Spielfiguren. Wenn ein Kind mit einem Kuscheltier in die Praxis kommt, finde ich spielerisch den Einstieg und frage, wer denn da mitgekommen ist und warum es auf mich so einen traurigen Eindruck macht. Die Kinder erzählen dann von ihrem Kuscheltier in allen Details, was in Wahrheit die eigene Geschichte widerspiegelt. Ausgelagert auf das Kuscheltier lässt es sich jedoch viel einfacher erzählen. Mit Matrjoschka-Puppen, die mehrfach ineinander gesteckt werden können, lässt sich hervorragend arbeiten, um behutsam den Gefühlen näher zu kommen. Die äußere Hülle, die oft Wut und Aggression zeigt, kann symbolisch geöffnet werden, um an die verborgene Trauer zu gelangen, an den verletzlichen Teil im Inneren.
In meiner Praxis berichten Trauernde immer wieder, wie schmerzhaft es für sie ist, zu beobachten, dass Mitmenschen ihnen aus dem Weg gehen. Womöglich erhalten sie den Kontakt nicht aufrecht, weil sie glauben, nicht die passenden Worte zu finden. Gleichzeitig wird berichtet, dass ein aufrichtig gemeinter Satz wie „Ich weiß gar nicht, was ich in dieser schweren Situation sagen soll“ für beide Seiten sehr entlastend wirken kann. Seien wir mutig, suchen wir das Gespräch mit Menschen, die trauern.
Quelle: Lichtblick - Magazin für praktizierte Individualpsychologie; Ausgabe 131 - März 2025

Simone Ringler, MSc
(Psychologin, Mediatorin,
syst. Coach und Supervisorin)
ist verheiratet und Mutter von vier erwachsenen Kindern
Webseite: www.ringler.co.at